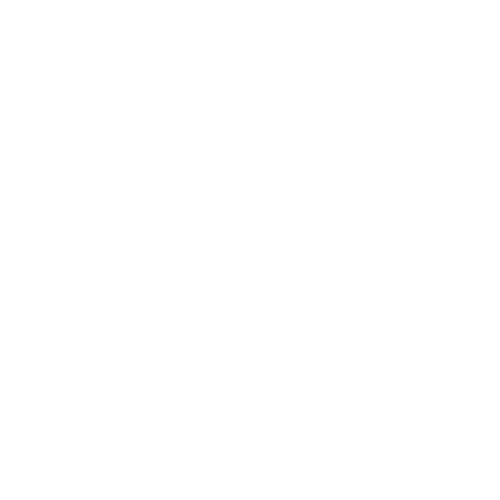Am 15. Januar hat die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Franken zum Euro aufgegeben, den sie am 6. September 2011 eingeführt hatte. Valentin Vogt sagte im November 2011 zur «Finanz und Wirtschaft»: «Wäre der Kurs auf 1.10 Franken geblieben oder hätte er sich der Parität angenähert, hätte es ein Schlachtfeld in der Schweizer Wirtschaft mit irreparablen Strukturschäden gegeben.» Wie beurteilt er die Lage heute?
Herr Vogt, ist die Schweizer Wirtschaft seit 2011 etwas widerstandsfähiger geworden?
Die Situation wäre ungefähr die gleiche wie damals zu 1.10 Franken, wenn der Franken zum Euro heute auf Parität stünde. Ein fairer Wechselkurs läge heute bei etwa 1.30 Franken Es ist viel passiert in den vergangenen drei Jahren. Sehr viele Unternehmen haben verschiedenste Massnahmen ergriffen und ihre Abhängigkeit vom Kurs des Frankens deutlich vermindert.
Sie sagten 2011, dass «nur eine weitere Schwächung des Frankens aus dem drohenden Krisenmodus herausführt». Sind wir nun so weit?
Das hängt davon ab, wo sich der Kurs nun einpendelt. Wenn das auf Parität oder sogar tiefer sein sollte, dann wäre ich für die konjunkturelle Entwicklung nicht sehr optimistisch. In diesem Fall ginge ich von schätzungsweise mindestens 40 000 Stellen aus, die innerhalb von Jahresfrist verloren gingen. Damit würde die Arbeitslosenrate auf gegen 5 Prozent steigen. Die Nationalbank würde wohl, als Teil ihres Auftrags, der konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu tragen, überlegen müssen, mehr Gegensteuer zu geben, etwa auf ein Kursziel von 1.10 Franken hin.
Was wäre auf diesem Kurs zu gewärtigen?
Auch zu 1.10 Franken wäre mit Strukturschäden zu rechnen, mit kurzfristig vielleicht 20’000 verlorenen Stellen. Bei einem Eurokurs von 1.15 Franken holpert es, aber es entstehen keine strukturellen Schäden. Das grösste Problem heute ist die Unsicherheit über die Kursentwicklung. Es fiel dem Präsidenten der SNB bestimmt nicht leicht, diesen schwierigen Entscheid – und damit quasi ein Nullwachstum – zu verkünden. Doch der Blick auf die Entwicklung der SNB-Bilanz zeigt, dass sie in diesem Takt nicht fortfahren konnte. Nun hat die SNB ihre Handlungsfreiheit zurückgewonnen. Die Gewerkschaften machen sich Illusionen, wenn sie nun verlangen, die SNB solle wieder ein Mindestkursziel durchsetzen. Diese Freiheit hat die SNB mit der Aufgabe der Mindestkursuntergrenze für absehbare Zeit verloren.
Wie lange braucht es, bis die Währungsrelation sich verlässlich eingependelt hat?
Ich rechne nicht mit Wochen, sondern mit einigen Monaten. Bis dann sollte die Eurozone in Bezug auf Griechenland einen Schritt weiter sein, die britischen Wahlen werden stattgefunden haben, wir werden klarer sehen, wie sich die wirtschaftliche Situation in Europa und die Lage in der Ukraine entwickeln. Was der Wechselkursschock tatsächlich bewirken wird, werden wir erst aus der Rückschau in drei, vier Jahren klarer erkennen können.
Wo drohen am ehesten Strukturschäden?
Schwer haben es diejenigen Unternehmen, deren Margen schon vor dem 15. Januar eng waren. Andere, wie etwa auch Burckhardt Compression, die zweistellige Betriebsgewinnmargen schreiben, können der Herausforderung deutlich entspannter begegnen als solche, die nun über Nacht in –5 oder –10 Prozent Ebit abgerutscht sind und Notmassnahmen ergreifen müssen.
Was für Betriebe dürften das sein?
Diejenigen, die hohe Einnahmen in Euro erwirtschaften, hohe Wertschöpfung in Franken haben und nur wenig im Ausland zukaufen können. In der Maschinenindustrie mit ihren insgesamt rund 400’000 Beschäftigten gibt es solche Betriebe, etwa kleinere Zulieferer der Automobilindustrie, Teilehersteller, Lohnfertiger. Daneben ist auch die in der Schweiz verbliebene Papierindustrie zu nennen, deren Geschäft ganz in Euro läuft. Besonders exponiert ist auch der Tourismus, der alle Kosten im Franken hat und nur wenig im Ausland zukaufen kann.
Was für Massnahmen stehen den Unternehmen überhaupt zur Auswahl?
Das muss jedes Unternehmen für sich selbst prüfen und entscheiden. Tabus kann es dabei keine geben. Kurzarbeit, wie sie von Gewerkschaften empfohlen wird, macht keinen Sinn, solange der Auftragsbestand hoch ist. Die Frankenstärke führt kurzfristig zu Kostenproblemen und nicht zu einer Nachfragekrise. Für Mitarbeitende, das sehe ich im Hause Burckhardt, ist nicht Zeit das knappe Gut, sondern Geld. Längere Arbeitszeiten sind für Mitarbeitende weniger schwierig zu verdauen als Lohnkürzungen. Georg Fischer, Bühler und Feintool zum Beispiel haben längere Wochenarbeitszeiten eingeführt. Wenn dagegen 20 Prozent Kurzarbeit eingeführt werden, erhalten die Beschäftigten 4 Prozent weniger Lohn.
Und notfalls schlicht die Löhne kürzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
Eigentliche Lohnsenkung kann nur die Ultima Ratio sein, wenn es ans Eingemachte geht. Wir sind der Auffassung, dass solche Massnahmen den Unternehmen in gewissen Fällen ermöglichen, den Beschäftigungsabbau am Standort Schweiz zu vermindern respektive hinauszuzögern, bis der Frankenkurs wieder auf einem vernünftigen Niveau ist. Wichtig ist, dass die Chefs ihren Beschäftigten die Lage erklären und sie dafür gewinnen, an einer Lösung mitzuwirken. Die Arbeitgeber müssen auch die Anliegen der Arbeitnehmer im Auge behalten. Wenn sich irgendwann die Situation aufhellt, gilt es, fair zu sein und etwa nach einer Phase mit zusätzlichen Wochenstunden beispielsweise einen Bonus auszurichten.
Löhne in Euro auszahlen: Ist das ein Weg?
Das ist eine Möglichkeit, die sich auf die Grenzgänger beschränkt. Nach unserer Auffassung ist das bei einer entsprechenden Ausgestaltung möglich. Die Entlohnung von Grenzgängern in Euro darf nicht zur Diskriminierung oder zum indirekten Lohndumping durch die Grenzgänger führen. Tritt dieser Effekt ein, droht die Festsetzung gesetzlicher Mindestlöhne in Normalarbeitsverträgen. Aber auch hier gilt das Gebot der Fairness. Es gibt Unternehmen, die dieses Prinzip seit Jahren zur Zufriedenheit der Mitarbeiter anwenden.
Es dürften weniger ausländische Unternehmen zuwandern, vielleicht einheimische abwandern. Droht Desindustrialisierung?
Die Gefahr besteht. Obschon in den vergangen zehn Jahren der Eurokurs von etwa 1.50 Franken auf bis vor kurzem 1.20 Franken gesunken ist, haben wir es geschafft, das Total von ungefähr 1 Million Arbeitnehmenden im verarbeitenden Sektor zu halten. Der Anteil am gesamten Arbeitsmarkt hat natürlich abgenommen, denn in dieser Zeit wurden in der Schweiz rund 500’000 Stellen neu geschaffen, vorwiegend im Dienstleistungssektor. Wir müssen uns bemühen, unsere Industriearbeitsplätze zu erhalten, denn das macht unsere Volkswirtschaft konjunkturresistenter als etwa die britische mit ihrem nur mehr marginalen Industrieanteil, wie sich während der Finanzkrise gezeigt hat.
Was kann die Politik tun, was nicht?
Es gibt ein Stichwort: Rahmenbedingungen. Kurzfristig kann die Politik nicht viel bewirken, abgesehen vom Erleichtern von Kurzarbeit bei Währungsturbulenzen. Bern tut gut daran, sich zurückzuhalten. Vor vier Jahren wollte man zuerst auch ein milliardenschweres Konjunkturpaket schnüren und hat dann aber letztlich davon abgesehen. Aus den Massnahmen, die ergriffen wurden, hat man gelernt. In den vier Jahren seit der letzten Eurokrise konnten von den 100 Millionen Franken, die für zusätzliche Hotelkredite bereitgestellt wurden, 25 Millionen Franken sinnvoll eingesetzt werden. Insgesamt sind so durch den Multiplikatoreffekt 250 Millionen Franken an Hotelinvestitionen unterstützt worden. Die Umsetzung solcher Massnahmen braucht Zeit und wirkt nicht kurzfristig. Wir sollten uns bewusst werden, dass wir nun über etwa zehn Jahre die Rahmenbedingungen fortlaufend verschlechtert und so viele Gesetze produziert haben wie früher in einem halben Jahrhundert. Wir müssen die Stärken des Landes wieder erkennen und sie nicht noch weiter schmälern.
Dazu trägt die Flut ökonomisch fragwürdiger Volksbegehren nicht eben bei.
Wir debattieren laufend schädliche politische Vorhaben – «1:12», Ecopop, bedingungsloses Grundeinkommen, AHV plus, Energie- statt Mehrwertsteuer etc. –, die für Verunsicherung sorgen. Besonders bei Ausländern, die solches weniger gut einordnen können als wir. Das Schweizer Volk pflegt zwar Absurditäten deutlich abzulehnen, doch unterschätzen dürfen wir derartige Vorstösse nicht. Sollte etwa die Erbschaftssteuerinitiative angenommen werden, wäre das ein grosses Problem vor allem für kleine und mittelgrosse Unternehmen. Die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit. In diesem Land bezahlen blosse 280 Gesellschaften die Hälfte der Unternehmenssteuern. Diese Gesellschaften brauchen klare, angemessene Regeln, etwa zu den Lizenzboxen, sonst findet ihr Geschäft plötzlich anderswo statt.
Eine Kapitalgewinnsteuer dürfte der Wirtschaft auch missfallen.
Kapital lässt sich besteuern entweder durch eine Vermögenssteuer, eine Kapitalgewinnsteuer oder eine Erbschaftssteuer. Die meisten Kantone setzen eines dieser Instrumente ein, gängig ist in vielen Kantonen die Vermögenssteuer. Was aber keinesfalls angeht, ist eine Kumulierung dieser Steuern. Eine national verordnete Kapitalgewinnsteuer brauchen wir in diesem Land nicht, das ist für die Wirtschaft eine «Red Line». Kapital ist mobil, das wird zu wenig zur Kenntnis genommen.