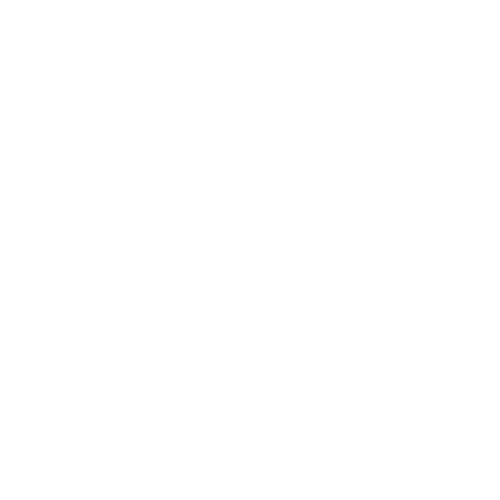Sie waren in den letzten Tagen wieder mit einer Selbstverständlichkeit zu lesen, die scheinbar keine Fragen offen lässt: Aussagen zur vermeintlichen Diskriminierung der Frauen in Sachen Entlöhnung. Dass Frauen 20 Prozent weniger verdienen als Männer, wurde unbesehen als Lohndiskriminierung ausgelegt. Ebenso pauschal wurde angeprangert, dass unterschiedliche Löhne für Männer und Frauen bei gleichwertiger Arbeit grundlos nach wie vor zum Berufsalltag gehören.
Gebetsmühlenartig landauf, landab und zuletzt wieder an einer Kundgebung in Bern wiederholt, stehen diese Verlautbarungen bei genauerem Hinsehen auf einer äusserst wackligen Grundlage. Wie der Schweizerische Arbeitgeberverband unlängst in einem Positionspapier zur Lohngleichheit und gegenüber den Medien festgehalten hat, ist die vom Bund angewandte Methode zur Berechnung der Lohndiskriminierung zwischen Frauen und Männern mangelhaft: Sie lässt offensichtlich lohnrelevante Merkmale – beispielsweise die effektive Berufserfahrung – ausser Acht. Von «Lohndiskriminierung» zu sprechen, ist darum reine Polemik und Stimmungsmache, wie auch die Basler Zeitung zu Recht kommentierte.
Mit redlicheren Argumenten wird im nördlichen Nachbarland gefochten, wo die Politik derzeit ebenfalls über gesetzliche Massnahmen gegen «Lohndiskriminierung» nachdenkt: In einer Studie des deutschen Statistikamts heisst es, dass Frauen zwar 22 Prozent weniger verdienen als Männer. Diese Differenz stelle aber keine Diskriminierung der Frauen dar, da sie strukturelle arbeitsmarktrelevante Unterschiede, dass beispielsweise Frauen seltener in Führungspositionen sind als Männer, in Branchen wie Verkauf oder Pflege stark vertreten sind und öfter Teilzeit arbeiten, ausklammert. Berücksichtigt man diese Merkmale, verringert sich der Abstand auf 7 Prozent. Aber auch diese Differenz sei keine Diskriminierung. Ausdrücklich verweist das Statistikamt auf den Umstand, dass es mangels Daten etwa Erwerbspausen für die Kindererziehung nicht einbeziehen konnte. Eine Lohndifferenz von sogar nur noch 2 Prozent ermittelte das Institut der deutschen Wirtschaft für Mütter, die nach der Geburt eines Kindes eine Erwerbspause von weniger als eineinhalb Jahren einlegten.
Zu Recht stellt ein entsprechender NZZ-Artikel fest, dass das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit» in der Theorie zwar gut tönt, aber den unterschiedlichen Facetten der einzelnen Mitarbeitenden nicht gerecht wird. Um dieser Individualität Rechnung zu tragen, muss der Lohn Gegenstand der Verhandlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bleiben – ohne Einmischung des Staates.
Das Bundesamt für Statistik wäre gut beraten, sich von seinem deutschen Pendant inspirieren zu lassen und sein Analyseverfahren ernsthaft zu überdenken.
In der Schweiz sind wir noch nicht so weit, dass die Lohndiskriminierung von offizieller Seite hinterfragt wird. Das Bundesamt für Statistik wäre gut beraten, sich von seinem deutschen Pendant inspirieren zu lassen und sein Analyseverfahren ernsthaft zu überdenken. Lohnen dürfte sich dabei auch ein Blick auf die verschiedenen Lohnkontrollsysteme, die Branchen und Unternehmen schon lange erfolgreich anwenden. Bisher hatte der Bund für die Anstrengungen der Privatwirtschaft im Bereich der Lohnkontrolle keinerlei Gehör. Ob daran der Wink aus Deutschland etwas ändert? Es bleibt zu hoffen!