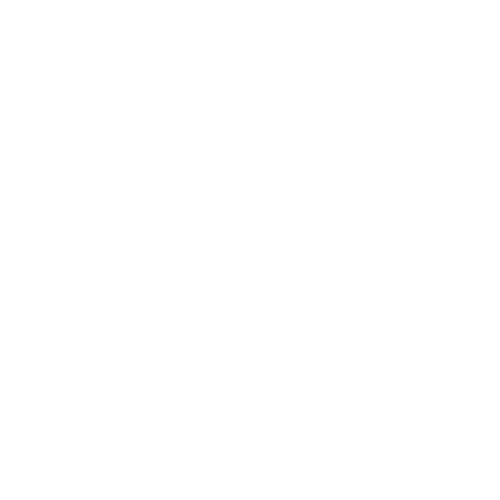Psychische Probleme am Arbeitsplatz sind ein brennendes Thema. Sie haben dazu verschiedene Studien durchgeführt – wie lauten Ihre Erkenntnisse?
Wir sehen etwa, dass in der Schweiz 75 Prozent der psychisch Erkrankten erwerbstätig sind. Darunter fallen natürlich nicht nur schwere, sondern auch leichte psychische Probleme. Die Zahl zeigt jedoch, dass psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz «normal» sind. Wenn man Vorgesetzte fragt, ob sie Erfahrung mit psychisch belasteten Mitarbeitenden hätten, so antworten 9 von 10 mit ja. Dennoch: Angesichts dessen, dass psychische Probleme am Arbeitsplatz ein so alltägliches Phänomen sind, sind die Arbeitgeber noch zu wenig vorbereitet darauf. In der HR-Ausbildung etwa wird der Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden bislang kaum thematisiert. Dass das Thema von Führungskräften derart breit wahrgenommen wird, drückt aber zumindest eine Sensibilisierung dafür aus. Das erachte ich als Chance, darauf können wir aufbauen.
Psychische Probleme von Mitarbeitenden strahlen aus. Inwiefern sind Vorgesetzte und Team von einer psychischen Erkrankung am Arbeitsplatz betroffen?
Die Belastungen sind erheblich – nicht nur für den betroffenen Mitarbeitenden, sondern auch für den Chef und das gesamte Team. Eine Umfrage zeigt, dass 60 Prozent der Vorgesetzten sich in einer solchen Situation ohnmächtig fühlen, 55 Prozent Konflikte mit dem Team oder dem eigenen Chef haben und 40 Prozent nach der Arbeit nicht mehr abschalten können. Diese Erkenntnisse sind alarmierend und verdeutlichen die Dimension psychischer Probleme am Arbeitsplatz. Es gibt Zweit- und Drittrundeneffekte, die neben persönlichen auch wirtschaftliche Folgen haben. Bereits leichtere psychische Probleme können so zu Produktivitätsverlusten führen.

Führungskräfte nehmen psychische Erkrankungen sehr wohl wahr. Auch fehlt es nicht an ihrem Engagement – die meisten Vorgesetzten führen viele und intensive Gespräche mit betroffenen Mitarbeitenden. Das zeigt: Die Früherkennung und der Einsatz der Arbeitgeber sind nicht unser grösstes Problem. Viel problematischer ist, dass Vorgesetzte psychische Schwierigkeiten erstens selten direkt ansprechen, dass sie zweitens zu lange das Falsche machen und dass sie drittens zu wenig ihre eigenen Erwartungen artikulieren. Dabei wäre es essenziell, dass Führungskräfte extern Hilfe holen – etwa bei den IV-Stellen oder den behandelnden Ärzten – und dass sie klare Vorgaben machen, die den Betroffenen Sicherheit vermitteln. Stattdessen appellieren viele Chefs an die Einsicht ihrer Mitarbeitenden. Nur: Menschen mit Persönlichkeitsproblemen oder -störungen, die einen grossen Teil der für Vorgesetzte belastenden Fälle ausmachen, können krankheitshalber nur bedingt einsichtig sein.
In den meisten Fällen enden solche Situationen deshalb in der Auflösung des betreffenden Arbeitsverhältnisses. Nicht mangels Engagement, sondern aus Überforderung. Würden mehr Arbeitgeber psychische Probleme direkter und früher ansprechen, zusammen mit Profis Bewältigungsstrategien entwickeln und klare, dennoch wertschätzende Bedingungen formulieren, blieben auch mehr Arbeitsplätze erhalten. Und die Arbeitsplatz-Erhaltung ist unser oberstes Ziel. Denn wer einmal verrentet wurde, fasst nur mehr schwer Tritt im Arbeitsmarkt.
Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Akteuren – Arbeitgeber, Arbeitnehmer, IV-Stellen, Versicherer, Ärzte – im Falle einer psychischen Erkrankung?
Leider noch nicht so gut, wie sie müsste. Wie gesagt, viele Führungskräfte fordern zu zögerlich externe Hilfe an. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass lediglich 5 Prozent der Arbeitgeber eine Meldung bei der zuständigen IV-Stelle machen – und das sieben Jahre nach Einführung dieses Instruments! Meldet sich ein Arbeitgeber bei der IV, so erhält er professionelle Unterstützung bei der Früherkennung und beruflichen Integration. Das Problem ist allerdings, dass die IV-Stellen noch zu wenig für ihre Services bekannt sind.
Unzureichend ist auch die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Ärzten. Es gibt hier ein strukturelles Problem, für das sowohl die Arbeitgeber als auch die Ärzte Verantwortung übernehmen müssen: Erstere müssen psychischen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz systematisch begegnen, letztere ihr teils zu enges Behandlungsverständnis erweitern. Beide Seiten müssen zudem lernen, aufeinander zuzugehen. Auch gilt es, Sicherheit im Umgang mit Datenschutz-Fragen zu gewinnen. Für all das brauchen wir mehr Sensibilisierung, Vernetzung und praxisbezogene Forschung. Initiativen wie der Verein Compasso für berufliche Integration (unter dem Patronat des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, Anmerkung der Redaktion) leisten hier bereits wertvolle Arbeit. Um die strukturellen Barrieren zu überwinden, braucht es aber ein grundlegendes Umdenken aufseiten der Arbeitgeber und Ärzte.
Was sollten Arbeitgeber und Vorgesetzte konkret tun, damit psychische Probleme früh erkannt werden und betroffene Menschen beruflich integriert bleiben?
Es muss eine Fehlerkultur geben. Psychische Schwierigkeiten müssen enttabuisiert werden. Das gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Vorgesetzte – auch Chefs haben persönliche Grenzen und Krisen. Das gehört zum Leben, auch zu einem psychisch gesunden Leben. Entscheidend ist aber, wie gut wir mit solchen Situationen umgehen. Noch einmal: Führungskräfte sollten psychische Probleme ohne Umschweife ansprechen und bei Bedarf externe Unterstützung anfordern – sei es bei der IV-Stelle, dem Krankentaggeld-Versicherer oder dem behandelnden Arzt – und Bedingungen stellen, etwa dass sich ein erkrankter Mitarbeitender in Behandlung begibt. Zudem finde ich es wichtig, dass es mit Blick auf die konkreten Arbeitsprobleme einen transparenten Austausch zwischen Arbeitgeber und Arzt gibt. Davon profitieren alle beteiligten Akteure – und damit gelingt auch die berufliche Integration eher.