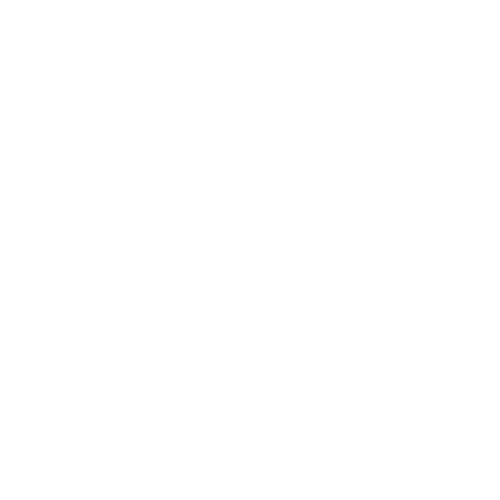Im Rahmen einer Revision der Sanierungsregeln im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG) soll eine gesetzliche Sozialplanpflicht eingeführt werden. Diese Referenz an alte gewerkschaftliche Forderungen ist eine «poison pill» für den Arbeitsmarkt, die den Arbeitnehmenden nicht gut bekommen wird.
Der Ständerat hat in der laufenden Session eine Revision des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts (SchKG) beschlossen, mit welcher die Sanierung von Unternehmen erleichtert werden soll. Zu diesem Zweck wird unter anderem Artikel 333b OR dahingehend geändert, dass der Übernehmer eines Betriebes im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nicht mehr wie nach geltendem Recht alle bisherigen Arbeitsverträge übernehmen muss.
Allenfalls entscheidet Schiedsgericht
Weil sich die Gewerkschaften in der Vernehmlassung gegen diese Lockerung (die notabene dem Erhalt eines Teils der Arbeitsplätze im Rahmen einer Sanierung dient!) gewehrt haben, wird nun als politischer «Ausgleich» in den Artikeln 335 h – k des Obligationenrechts eine Sozialplanpflicht eingeführt. Unternehmen mit über 250 Beschäftigten, die mehr als 30 Mitarbeitende entlassen, müssen mit den Arbeitnehmern über den Abschluss eines Sozialplans verhandeln.
Können sich die Parteien nicht einigen, setzt ein Schiedsgericht den Sozialplan fest, wobei dieser den Fortbestand des Betriebes nicht gefährden darf.
Politischer Kuh-Handel
Der Ständerat hat einen Streichungsantrag mit 26 zu 11 Stimmen abgelehnt und damit einem bedenklichen politischen Kuh-Handel seinen Segen gegeben. Der politische Ausgleich zugunsten der Arbeitnehmerseite ist umso fragwürdiger, als die neue Regelung für die Sanierungs-Tatbestände, welche eigentlich Gegenstand der Revisionsvorlage sind, gerade nicht gelten soll. Er diente als Scheinargument, mit dem verschiedene Standesherren einen Eingriff in die Kündigungsfreiheit rechtfertigten, nachdem sie zuerst das hohe Lied der liberalen schweizerischen Arbeitsmarktordnung gesungen hatten.
Wie stark das politische Kalkül den Entscheid der kleinen Kammer bestimmte, zeigt auch die Einschränkung der Sozialplanpflicht auf grössere Firmen. Sie bezahlen bei einer Restrukturierung aus eigener Kraft den (politischen) Preis für die leichtere Rettung jener Unternehmen, die nur noch mit Hilfe des gesetzlichen Sanierungsinstrumentariums überleben können. Diese absurde Logik passt ebenso wenig zur «chambre de reflexion» wie die rechtlichen Detail-Fragen, welche die neuen Regeln offen lassen.
Angriff auf bewährtes System zu einem hohen Preis
Was die Gewerkschaften für die Revisionsvorlage gewinnen soll, platziert im Arbeitsmarkt eine «poison pill» (Giftpille), die den Arbeitnehmenden nicht gut bekommen wird. Die bisherige Ordnung, nach welcher die Sozialplanfrage den Sozialpartnern überlassen bleibt, hat sich bewährt. Gestützt auf gesamtarbeitsvertragliche Regeln entwickelten sich differenzierte «Sozialplan-Kulturen», welche den branchenspezifischen Bedürfnissen und Besonderheiten Rechnung tragen.
Eine gesetzliche Uniformierung der Sozialpläne führt dagegen zur unverhältnismässigen Verteuerung von Restrukturierungsmassnahmen und damit zu einer erheblichen Beschränkung der Arbeitsmarktflexibilität. Unter dem Regime rigider Sozialplanverpflichtungen zögern die Unternehmen mit Personaleinstellungen, weil sie die Kosten später eventuell nötiger Abbaumassnahmen fürchten. Dieser faktische «Lock-Out-Effekt» ist ein hoher Preis für die gesetzliche Sozialplanverpflichtung; bezahlen werden ihn dereinst die Arbeitnehmenden.