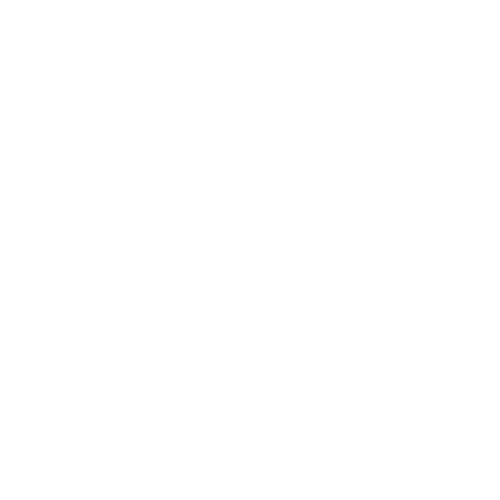Herr Vogt, die Schweiz hat in dieser zweiten Welle sehr hohe Infektionszahlen und im Vergleich zu den Nachbarstaaten geringere Einschränkungen. Sind wir das neue Schweden?
Wir haben unser eigenes Konzept. Wenn man eine Strategie einmal festgelegt hat, ist es das Schlimmste, diese dauernd zu ändern. Den Weg, den wir nun eingeschlagen haben, sollten wir durchziehen. Wir können erst in ein paar Jahren beurteilen, was erfolgreich war und was nicht.
Was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, mit Ihrem Widerstand gegen einen harten Lockdown setzten Sie unnötigerweise die Gesundheit der Bevölkerung, ja sogar Leben aufs Spiel?
Es gibt keinen Widerspruch zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Wir tun unser Möglichstes, um ein Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Wirtschaft zu finden. Aber wenn wir unsere Wirtschaft stark schädigen, werden wir grosse Probleme haben, unseren Wohlstand und unseren hohen Lebensstandard zu halten. Nicht nur Unternehmen, auch Arbeitnehmer profitieren von einer gesunden Wirtschaft.
Epidemiologen warnen vor dem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen. Man solle das wirtschaftliche Leben frühzeitig abbremsen, damit die Lage nicht ausser Kontrolle gerate.
Mit Blick auf die Auslastung der Spitäler haben wir bis jetzt keine schweizweite Krise. Die Krankenhäuser wollen eine ähnliche Situation wie im Frühling verhindern. Sie haben damals alle Kapazitäten und Notfallkonzepte hochgefahren, doch der befürchtete Ansturm blieb grösstenteils aus, so dass sie ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken mussten.
Bundesrat Alain Berset hat kürzlich die Kantone und Spitäler hart kritisiert, die ihre Kapazitäten nicht erhöhen und weiterhin nicht dringende Operationen durchführen.
Es ist an den Kantonen, hier ein Gleichgewicht zu finden. Wenn die Spitäler nicht ausgelastet sind, fallen die Infrastrukturkosten trotzdem an.
Werden wir nun bis in den nächsten Sommer hinein von einem Lockdown zur nächsten Lockerung und wieder zum nächsten Lockdown stolpern?
Wir müssen einen solchen Jo-Jo-Effekt unbedingt vermeiden und uns darauf einstellen, dass das jetzige Regime bis im Frühjahr gelten wird. Immerhin hat die zweite Welle das wirtschaftliche Leben bisher deutlich weniger beeinträchtigt als die erste Welle. Die Schulen, die Grenzen und auch die Läden in den meisten Kantonen bleiben geöffnet. Auch der private Konsum ist bisher nicht eingebrochen. Aber wir haben derzeit 150 000 Arbeitslose, und schätzungsweise 300 000 Leute sind in Kurzarbeit.
Ist das nicht beunruhigend?
In Anbetracht der Umstände nicht. Es ist eher die langfristige Situation, die mir Sorgen bereitet. Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Frühling deutlich mehr als 200 000 Arbeitslose haben werden und eine Welle von Konkursen auf uns zurollen wird.
Was ist dagegen zu tun?
Wir müssen den jetzigen Weg weitergehen und nur die unbedingt notwendigen Einschränkungen dezentral verfügen. Und wir müssen mit den bewährten Krisenstabilisatoren arbeiten. Der wichtigste Stabilisator ist und bleibt die Kurzarbeit. Es gilt zudem, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht weiter zu verschlechtern und uns nicht dauernd ins eigene Knie zu schiessen, wie zum Beispiel mit der Unternehmensverantwortungsinitiative. Wir brauchen auch keine Konjunkturprogramme. Die wirken erst dann, wenn man sie nicht mehr braucht.
Der Arbeitgeberverband hat aber zusammen mit den Gewerkschaften schnellere Härtefallhilfen für Unternehmen gefordert. Es gibt schon Kurzarbeitsentschädigung, Arbeitslosenhilfe, Covid-19-Kredite. Wieso braucht es noch mehr staatliche Unterstützung?
Verschiedene Branchen sind in eine schwere Krise geraten, ohne dass sie strukturelle Probleme hätten. Nehmen Sie die Stadthotels in Zürich. Vor der Krise gab es eher zu wenige. Jetzt sind sie noch etwa zu 10% ausgelastet. Wir sollten sie nicht alle in Konkurs gehen lassen. Sonst ist die Infrastruktur zerstört, wenn der Tourismus und die Geschäftsreisen wieder anziehen. Wir haben im geschilderten Fall keine Struktur-, sondern eine Covid-19-Krise.
Bundesrat Ueli Maurer hat vergangene Woche gemahnt, es könne nicht sein, dass der Steuerzahler der Soldat in der ersten Reihe sei.
Das sehe ich auch so. Bei Härtefällen müssen auch die Eigentümer und Kreditgeber geradestehen. Im Moment sind viele kleine und mittelgrosse Unternehmen in einer ausgesprochen schwierigen Situation. In einigen Branchen geht es nun ums Überleben. Wie wir die Widerstandskraft unserer KMU-Wirtschaft stärken, sollten wir nach der Krise angehen – beispielsweise durch steuerliche Anreize, damit die Betriebe mehr Eigenkapital halten. Die Führung und Verantwortung für Notfallhilfen liegt bei den Kantonen, der Bund finanziert nur mit, das finde ich positiv. Die Situation der Hotellerie in Graubünden ist eine andere als diejenige in Zürich. Flächendeckende Subventionen bringen nichts. Wir sollten auch nicht wieder zur ausserordentlichen Lage zurückkehren.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass man mit solchen Unterstützungsmassnahmen Strukturerhaltung betreibt?
Die Kunst der Härtefallregelung wird es sein, herauszufinden, welche Betriebe längerfristig wettbewerbsfähig sind und welche nicht. Es handelt sich um einen schmalen Grat, den es zu bewältigen gibt. Die Härtefallregel ist nur als letzter Ausweg gedacht.
Sind Sie mit der Verordnung des Bundesrates für eine Härtefallregelung zufrieden?
Die Vernehmlassung läuft im Moment, und wir werden uns aktiv einbringen. Wenn wir bis im Sommer darüber diskutieren, dann kommt die Hilfe zu spät. Ich denke, bei der Umsetzung der Härtefallregelung könnten auch die Banken wieder eine Rolle spielen. Sie wissen, welche Unternehmen in den zurückliegenden Jahren gut unterwegs waren und unverschuldet in Probleme geraten sind. Wir sollten jetzt vor allem schnell und stufenweise vorgehen. Deshalb haben wir auch beim Bundesrat interveniert, das hat mitgeholfen, dass die Härtefallregelung schon Anfang Dezember zur Verfügung stehen wird.
Täuscht der Eindruck, dass die Krise die Sozialpartner näher zusammenbringt?
Personelle Wechsel auf gewerkschaftlicher Seite haben auch dazu beigetragen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Pierre-Yves Maillard, der neue Präsident des Gewerkschaftsbundes, war zwölf Jahre lang Regierungsrat. Hierfür muss man, unabhängig von der politischen Ausrichtung, einen gewissen Pragmatismus entwickeln.
Sie haben den Bundesrat zusammen mit dem Gewerkschaftsbund aufgefordert, einen zweiten Lockdown mit allen Mitteln zu verhindern. Das ist bemerkenswert.
Auch die Gewerkschaften haben aus den Folgen der ersten Welle gelernt. Im Frühjahr wollte die Unia noch die gesamte Wirtschaft lahmlegen. Das war und ist der falsche Weg. Ich denke, die Gewerkschaften haben verstanden, dass arbeitende Unternehmen und Mitarbeitende wichtiger sind als sämtliche Hilfsmassnahmen. Wir haben uns gemeinsam für gut funktionierende Schutzkonzepte eingesetzt.
Weshalb müssen Sie denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wieder dazu auffordern, sich an die Schutzkonzepte zu halten?
Wir müssen den Arbeitnehmern klarmachen, dass es bei der Einhaltung der Schutzkonzepte kein Nachlassen geben darf, auch wenn sie den Betrieb verlassen. Die Leute stecken sich in der Regel nicht im Unternehmen an, sondern in ihrer Freizeit oder im Familienkreis.
Einige der nun erzwungenen drastischen Veränderungen dürften auch nach der Krise Bestand haben. Etwa, dass man öfter von zu Hause aus arbeitet.
Einige Unternehmen werden ihren Mitarbeitern auch nach der Krise tageweise erlauben, zu Hause zu arbeiten. Andere werden möglicherweise ihre Bürofläche reduzieren und ihre Mitarbeiter einen grossen Teil der Arbeit im Home-Office ausführen lassen.
Sollten dann die Arbeitgeber den Mitarbeitern nicht auch finanziell helfen, ihr Büro zu Hause adäquat einzurichten?
Dort, wo es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, sehe ich keine Verpflichtung. Wo zum Beispiel die Bürofläche um ein Drittel reduziert wird und die Mitarbeiter keinen festen Arbeitsplatz mehr haben, hingegen schon. Ich habe aber wenig Verständnis dafür, wenn in der grössten wirtschaftlichen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, in der es nun darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, als Erstes wieder Forderungen an die Arbeitgeber gestellt werden. Das sollte man nach der Krise regeln, und es braucht das persönliche Gespräch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Im «Lehrstellen-Puls» der ETH gaben 18% der befragten Firmen an, im nächsten Jahr weniger Lehrstellen anbieten zu wollen. Steht die Zukunft unseres dualen Berufsbildungssystems auf dem Spiel?
Nein, das glaube ich nicht. Schweizweit sind in diesem Jahr etwa gleich viele Lehrverträge abgeschlossen worden wie 2019. Wir sehen auch, dass die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen, die jetzt ihre Lehre abgeschlossen haben, wie in anderen Jahren nach den Sommerferien sinkt. Ich bin Präsident von Check Your Chance, einer Dachorganisation gegen Jugendarbeitslosigkeit. Acht Vereine helfen insgesamt jährlich 5000 Jugendlichen, den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Das ist wichtig. Die Berufslehre ist einer der zentralen Faktoren, wieso wir in der Schweiz eine tiefe Arbeitslosigkeit und auch eine hohe Integration der Zuwanderer haben.
Aber die Jugend verzeichnet jetzt unter allen Altersgruppen die höchste Arbeitslosigkeit.
In einer Krise sind die Jugendlichen die Ersten, die getroffen werden, aber auch die Ersten, die wieder eine Stelle finden. Bei den Älteren ist es genau umgekehrt. Wir gehen davon aus, dass es derzeit nebst den 18 000 Jugendlichen, die arbeitslos gemeldet sind, noch gut 40 000 weitere gibt, die grundsätzlich arbeitswillig wären, aber ein Zwischenjahr oder etwas anderes machen, weil sie keine Arbeit gefunden haben. Das darf nicht zu einem Dauerzustand werden.
Wie kann man Lehrlinge ausbilden, wenn man im Home-Office ist?
Lehrlinge gehen zwei Tage zur Schule, in der restlichen Zeit muss die Ausbildung im Betrieb stattfinden. Nur etwa ein Fünftel aller Arbeitsplätze eignet sich für eine Verschiebung ins Home-Office. Bäcker, Krankenschwestern und Maurer können nicht von zu Hause aus arbeiten.
Dieses Jahr gab es vielenorts zwar eine Abschlussarbeit, aber keine Abschlussprüfung. Ist das nicht von Nachteil?
Wir haben uns dagegen gewehrt und waren nur teilweise erfolgreich. Ich finde, eine Abschlussprüfung gehört dazu, auch bei den Maturanden. Ich sehe nicht ein, wieso man eine Maturaprüfung nicht mit genügend Abstand beispielsweise in Turnhallen durchführen kann.
Ist die Jugend der grosse Verlierer in dieser Corona-Krise?
Damit das nicht passiert, müssen wir jetzt lernen, mit dieser schwierigen Pandemiesituation vernünftig zu leben und unser Berufsbildungssystem und unsere Wirtschaft am Laufen zu halten.
Nun steht aber die Konzernverantwortungsinitiative zur Abstimmung an, die den Unternehmen das Wirtschaften schwerermachen will. Wie erklären Sie sich die grosse Unterstützung, die diese Initiative in der Bevölkerung geniesst?
Mit bewusster Fehlinformation und einer langfristig angelegten Kampagnenstrategie. Wir Arbeitgeber sind auch für die Einhaltung von Umweltstandards und Menschenrechten! Aber dazu brauchen wir nicht ein neues Bürokratiemonster. Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam nach Lösungen gesucht und würden mit dieser Initiative stattdessen auf Konfrontation und Konflikt setzen.
Wie meinen Sie das?
Es wäre ja kaum so, dass der Kaffeebauer aus Côte d’Ivoire alleine gegen ein Schweizer Unternehmen klagen würde, sondern das würde irgendeine NGO im Auftrag des Kaffeebauern übernehmen. Diese würde die Drohung mit einem langwierigen Verfahren vor einem Schweizer Gericht zu einem Sachverhalt in einem fremden Entwicklungsland dazu nutzen, eine Firma unter Druck zu setzen. Das würde zu einem massiven Ausbau der weltweiten Klageindustrie führen. Die Firmen müssten Vergleiche eingehen, und die Schweiz würde sich als Weltpolizist aufspielen.
Ist es denn so schwer, sich vor Vorwürfen zu schützen?
Das Tüpfchen auf dem i ist ja die Umkehr der Beweislast. Das wäre, als ob Sie mit 30 km/h durch Zürich fahren, ein Polizist Sie anhalten und sagen würde, er glaube, Sie seien 50 km/h gefahren, und Sie müssten ihm jetzt das Gegenteil beweisen. Es ist oft schlicht unpraktikabel, mit vernünftigem Aufwand die Lieferkette bis ins letzte Detail zu kontrollieren. Da werden manche Unternehmen die Risiken als zu kostspielig erachten und sich zurückziehen. Diejenigen, die nachrücken, werden bestimmt nicht nach Schweizer Standards operieren.
Haben Sie ein Beispiel?
Die Sportsevision AG in Rorschach zum Beispiel, die entwirft und produziert LED-Werbung für Schweizer Sportstadien. Die Firma hat eine chinesische Tochtergesellschaft, welche die Panels in China herstellt und dann auch in die Schweiz liefert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Schweizer Firma mit vierzehn Mitarbeitenden in der Schweiz mit verhältnismässigem Aufwand die Produktion in China und ihre Zulieferer lückenlos kontrollieren könnte.
Die Initianten behaupten, solche KMU wären von der Initiative gar nicht betroffen.
Ich lese den Initiativtext, über den wir abstimmen. Alle KMU müssten demnach haften. Gleichzeitig solle man aber auf sie, sofern sie zu den Unternehmen mit geringen Risiken gehörten, bei den Sorgfaltspflichten Rücksicht nehmen. Was soll das heissen? Es würde die ganze Wirtschaft treffen, auch über die Haftungsregeln, die die grossen Konzerne an ihre Zulieferer weitergeben müssten.
Was ist denn Ihr Vorschlag, wie Schweizer Firmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und den Menschenrechten in Entwicklungsländern angehalten werden könnten?
Der Gegenvorschlag ist die gangbare Antwort auf das Bedürfnis, Verantwortung und Rechenschaft bei der Einhaltung von Umweltstandards und Menschenrechten noch stärker einzufordern. Er tritt umgehend in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird.
Mit der «Abzocker»-Initiative haben sich die Unternehmen schliesslich arrangiert, wäre das bei einer Annahme der Konzernverantwortungsinitiative anders?
Die Schweiz würde glücklicherweise mit der Annahme der Initiative nicht untergehen. Aber es wäre wieder ein dickes Salamirädchen mehr, das man abschneiden würde. Man kann sagen, das sei nicht so schlimm. Aber wenn man es oft genug gemacht hat, ist der Salami einfach weg. Wir sind auf gutem Weg, genau das zu tun. Wir verzehren unseren Wohlstand.
Dieses Interview mit Valentin Vogt ist in der «NZZ» erschienen.