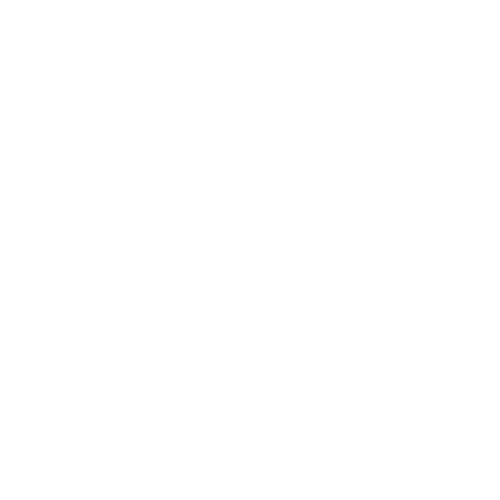Sind Sie zufrieden mit der vom Nationalrat verabschiedeten Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative (MEI) vom letzten Mittwoch?
Für uns geht der Entscheid in die richtige Richtung. Es ist insbesondere wichtig, dass sich der Nationalrat für eine Lösung entschieden hat. Der Zeitplan für die Umsetzung der MEI ist sehr eng. Für die Wirtschaft ist der Erhalt der bilateralen Verträge mit der EU entscheidend – und dass die Schweiz Teil des Forschungsprogramms Horizon 2020 bleibt. Es stört mich, dass es in Bern Parlamentarier gibt, die trotz dem engen Zeitplan noch taktieren.
An was oder wen denken Sie da konkret?
Zum Beispiel an die Aussage eines Ständerates, der gesagt hat, es sei nicht wichtig, was der Nationalrat beschliesse, der Ständerat werde es dann inhaltlich schon richten.
Sie haben ja schon öffentlich kommuniziert, dass der Arbeitgeberverband eine etwas schärfere Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative bevorzugen würde. Wieso will der Arbeitgeberverband weiter reichende Massnahmen, als jetzt der Nationalrat beschlossen hat?
Wir könnten uns als Wirtschaft ja einfach zurücklehnen und dankbar für die Umsetzung mit dem «Inländervorrang light» sein. Aber ich glaube einfach, dass diese Haltung zu kurz greift. Der im Nationalrat beschlossene «Inländervorrang light» lässt die innenpolitische Sicht völlig ausser Acht. Wir brauchen endlich wieder eine innenpolitische Stabilität in der Schweiz. Es nützt nichts, wenn wir jetzt etwas umsetzen, das schon nächstes Jahr wieder mit einer Initiative, die womöglich die Abschaffung der Personenfreizügigkeit fordert, angegriffen wird. Der Arbeitgeberverband will auch signalisieren, dass die Wirtschaft bereit ist, ihren Beitrag zur Senkung der Zuwanderung zu leisten. Wir haben ja auch mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzungsdebatte beigetragen: Ich denke da an das zusammen mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich entwickelte Zürcher Berufsgruppenmodell.
Können Sie das besagte Modell nochmals kurz umreissen?
Es ist ein Indikatoren-Modell mit 97 Berufsgruppen, das hilft, Mangelberufe beziehungsweise Berufe, wo genügend Inländer vorhanden sind, zu identifizieren. Das Modell beruht auf verschiedenen für den Arbeitsmarkt wichtigen Faktoren, wie zum Beispiel den Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung oder der Anzahl offener Stellen gegenüber der Anzahl Stellensuchender. Darauf aufbauend wird bestimmt, für welche Berufsgruppen eine Meldepflicht für die Arbeitgeber einzuführen ist. Es macht eben keinen Sinn, wenn man für Berufsfelder Leute aus dem Ausland holt, solange in diesen Berufsgruppen eine hohe Arbeitslosigkeit in der Schweiz besteht. Zumal dies natürlich auch die Arbeitslosenkasse stark belastet. Nur ein Beispiel hierzu: Die Arbeitslosigkeit der 29’000 Stellenlosen im Kanton Zürich kosten die Arbeitslosenkasse zehn Millionen Franken – pro Tag.
Es ist demnach auch in Ihrem Vorschlag lediglich eine Meldepflicht vorgesehen und kein richtiger Inländervorrang. Wenn der Arbeitgeber den inländischen Arbeitnehmer nicht will, so kann er ohne Einschränkung auch den ausländischen anstellen?
Ja, das ist die Idee: Die Arbeitgeber erhalten die Dossiers der inländischen Arbeitnehmer von den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons innerhalb von 48 Stunden. Wenn die vorgeschlagenen Arbeitnehmer nicht passen, dann müssen sie diese nicht anstellen und sich auch nicht rechtfertigen.
Greift denn eine so verstandene Meldepflicht überhaupt? Sinken damit die Zuwanderungszahlen?
Der Kanton Zürich hat berechnet, dass auf Basis einer Meldepflicht letztes Jahr rund 2000 bis 3000 Stellen hätten besetzt werden können und dadurch die Zuwanderung entsprechend gesunken wäre. Für die gesamte Schweiz gehen wir von 6000 bis 11’000 Stellen pro Jahr aus. Die Meldepflicht sollte man umgehend einführen, um Erfahrung zu sammeln und zu beobachten, ob sie Wirkung zeigt. Wenn dem nicht so wäre, dann würde die zweite Stufe unseres Vorschlags greifen: Der Bundesrat wäre dann ermächtigt, weitere Abhilfemassnahmen zu ergreifen. Darunter könnte zum Beispiel eine Nachweispflicht des Arbeitgebers für bestimmte Berufsgruppen ohne Mangel im Inland fallen, wie wir sie auch schon bei den Drittstaaten kennen: Der Arbeitgeber muss dabei ausführlich begründen, wieso er keinen inländischen Arbeitnehmer für die entsprechende Stelle findet.
Haben Sie das Gefühl, dass vonseiten der Wirtschaft dem Volkswillen genug Rechnung getragen wird?
Etwa die Hälfte der Zuwanderung ist direkt mit der Erwerbstätigkeit verbunden. Und der Familiennachzug, der mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängt, hält sich in Grenzen. Bei den EU/Efta-Staaten haben wir circa 20 Prozent Familiennachzug. Das heisst, pro fünf Arbeitskräfte kommt eine zusätzliche Person ohne Erwerbstätigkeit in die Schweiz. Bei der Einwanderung aus Ländern in Südosteuropa, die nicht Teil der EU/Efta-Staaten sind, ist dieses Verhältnis fast eins zu eins. Hier muss man auch ansetzen. Nur immer auf die Wirtschaft einzuprügeln, wenn es um die Zuwanderung geht, ist eine etwas einfache Sichtweise. Nur wenn die Zuwanderung in allen Bereichen zurückgeht, werden wir die gewünschte Wirkung erzielen. Die Wirtschaft alleine kann es nicht richten.
Entscheidend für die Wirtschaft ist doch, dass sie vor allem bei den Spezialisten, den Hochqualifizierten möglichst grosse Flexibilität haben muss, um diese anzustellen…
Genau: Es macht eben keinen Sinn, bei Ärzten eine Meldepflicht einzuführen. Ursprünglich hat man von einer Meldepflicht für Branchen gesprochen. Wenn Sie beispielsweise heute einen Bauführer suchen, ist das schwierig auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Demgegenüber gibt es bei den Hilfsarbeitern auf dem Bau ein Überangebot. Eine generelle Meldepflicht für die gesamte Baubranche ist da wenig zielführend.
In der Parlamentsdebatte zur Masseneinwanderungs-Initiative hat man vernommen, dass eine schärfere Umsetzung von der EU nicht akzeptiert würde. Ihr Vorschlag geht über den nun verabschiedeten «Inländervorrang light» hinaus. Wieso denken Sie, dass Ihr Vorschlag von der EU akzeptiert werden würde?
Die darin vorgesehene Meldepflicht ist ja offenbar kein Problem, das machen schon neun EU-Staaten heute so. Das andere ist die von uns vorgeschlagene 60-Tage-Regel: Der Bundesrat könnte also einseitig verhältnismässige Massnahmen beschliessen, sofern der gemischte Ausschuss, der aus Vertretern der Schweiz und der EU zusammengesetzt ist, innerhalb von 60 Tagen keine Lösung findet. Auch hier sind wir der Ansicht, dass dies dem Personenfreizügigkeitsabkommen nicht widerspricht. Ähnliches wurde übrigens auch schon in der Vergangenheit gemacht: Ich erinnere an die flankierenden Massnahmen und auch an die Acht-Tage-Regel. Die EU hat diese Massnahmen nie gutgeheissen, doch sie akzeptiert sie.
SP-Nationalrat Cédric Wermuth sagt ganz offen: Die Linke will für ihre nationalrätliche Zustimmung zur Umsetzung im Ständerat zusätzliche flankierende Massnahmen. Wie finden Sie das?
Für uns sind zusätzliche flankierende Massnahmen eine rote Linie. Wir werden keine weiteren Eingriffe in den Arbeitsmarkt akzeptieren. Bei dieser Frage sind die bürgerlichen Parteien geschlossen. Denn wenn wir auch hier noch weiter gehen, befinden wir uns dann irgendwann zwischen Hammer und Amboss: Auf der einen Seite ein stark regulierter Arbeitsmarkt, auf der anderen Seite riskieren wir durch weitere Initiativen den Verlust der Bilateralen. Das wäre dann der Super-GAU für die Schweiz.
Die Wirtschaft betont immer wieder den Nutzen der Zuwanderung. Auf der anderen Seite verursacht diese auch Kosten. Wo sehen Sie solche?
Natürlich, die gibt es. Vor allem auch, wenn eine «falsche» Zuwanderung stattfindet. Man wird dies über kurz oder lang dann in den Sozialwerken, zum Beispiel in der Arbeitslosenversicherung, sehen. Das ist nicht das Ziel der Zuwanderung aus Sicht der Wirtschaft. Kosten-Nutzen-Abwägungen sind sicher ein Thema, wenn man über die Zuwanderung spricht. Doch das wichtigste Zukunftsthema des schweizerischen Arbeitsmarkts ist die Demografie: Wir haben dieses Jahr circa 5000 Leute mehr, die in die Pension gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten. In zehn Jahren sind es dann 50’000 pro Jahr. Das ist in etwa einmal die momentane jährliche Zuwanderung. In zehn Jahren werden uns circa 400’000 Arbeitskräfte fehlen. Wir werden also auch in Zukunft immer auf eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt angewiesen sein, wenn wir die wirtschaftliche Stärke unseres Landes erhalten wollen.
Die Zuwanderungsfrage spaltet die bürgerlichen Parteien seit Jahren. Wir haben das auch jetzt wieder erlebt. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Vorstoss von allen bürgerlichen Parteien mitgetragen wird?
Es ist die Aufgabe der Wirtschaft, ihre Anliegen frühzeitig in den politischen Prozess einzubringen. In unserem politischen System gilt das Primat der Politik. Die bürgerlichen Parteien sind das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, gemeinsam und regelmässig am gleichen Tisch gesessen und haben eine gemeinsame Lösung zum Thema Zuwanderung gesucht. Leider hat es bis jetzt noch nicht zu einer gemeinsamen bürgerlichen Lösung geführt. Der Entscheid im Nationalrat ist erst die zweite Etappe im parlamentarischen Umsetzungsprozess der Masseneinwanderungs-Initiative.
Von aussen hat man den Eindruck, dass diese Spaltung in der Zuwanderungsfrage die bürgerlichen Parteien davon abhält, Wirtschaftspolitik zu machen. Man verhandelt primär die strittigen Fragen, vernachlässigt dabei die vorhandenen Gemeinsamkeiten…
Da stimme ich Ihnen zu. Es geht dadurch sehr viel Energie verloren. Insgesamt gibt es zwei Themen im bürgerlichen Block, in denen es grössere Differenzen gibt: bei der Zuwanderung sowie bei gewissen Fragen in der Gesellschaftspolitik. Bei der Steuer-, der Infrastruktur- oder der Energiepolitik funktioniert die Zusammenarbeit gut. Auf alle Fälle deutlich besser als noch vor den Wahlen 2015. Wenn man sich dann aber das Schauspiel vor Augen führt, das während der Zuwanderungsdebatte im Nationalratssaal geboten wurde, kann man sich schon fragen, wie viel Gemeinsamkeiten vorhanden sind.
Wie hat das auf Sie gewirkt?
Ich fand es persönlich über weite Strecken eher peinlich. Das muss ich schon sagen. Es ging bei der Debatte um eines der wichtigsten politischen Dossiers in diesem Land. Und da vermisste ich die gebotene Sachlichkeit. Bei der Debatte ging es um unser Land und um eine Frage mit enormer Tragweite.
Mit der Inländervorrang light»-Umsetzung ist man das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU los. So wurde zumindest immer wieder argumentiert. Teilen Sie diese Einschätzung?
Wichtig ist hier, dass man die zwei Dossiers nicht miteinander verknüpft. Wir müssen hier einfach auch unsere innenpolitischen Möglichkeiten kennen. Nur schon der Begriff «fremde Richter» löst hierzulande breiteste Aversionen aus. Wir müssen abwarten, wie das Resultat der Brexit-Verhandlungen aussehen wird. Dass wir uns irgendwann mit dem Thema des institutionellen Abkommens auseinandersetzen müssen, ist jedoch auch klar. Denn auch die Schweiz hat Dossiers, in denen wir Interessen haben, die wir gerne mit der EU verhandeln würden. Stichwort Stromabkommen.
Der Bundesrat hat bezüglich der Zuwanderungsbegrenzung ja schon gehandelt: Er hat das Drittstaatenkontingent eingeschränkt. Diese Massnahme ist wohl nicht im Sinne der Wirtschaft?
Das war aus meiner Sicht reine Symbolpolitik. Diese Entscheidung kann ich aus wirtschaftlicher Sicht nicht nachvollziehen. Es zielt in die falsche Richtung. Hier geht es um die Zuwanderung von Hochqualifizierten. Diese haben einen Multiplikatoreneffekt für Arbeitsplätze von Schweizern. Wir hoffen, dass da der Bundesrat auf seine Entscheidung vom Herbst 2014 zurückkommt und die 2000 gestrichenen Kontingentsplätze wieder freigibt und auf das alte Niveau von 2014 zurückkehrt. Das befürwortet ja sogar die SVP.