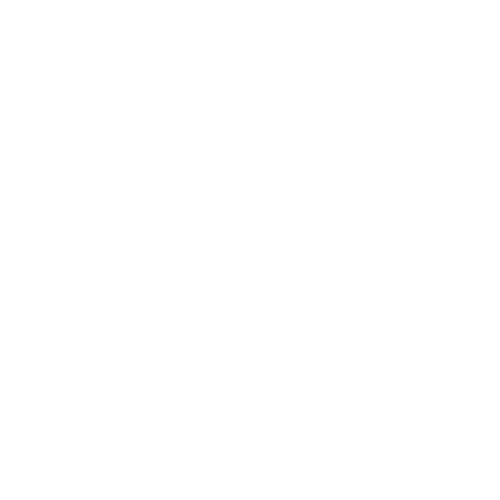Herr Vogt, die nationalrätliche Sozialkommission macht einen Schritt in Richtung Rentenalter 67 und will für die AHV eine Schuldenbremse. Freuen Sie sich darüber?
Die Entscheide gehen in die richtige Richtung. Das Parlament muss aber aufpassen, dass es das Fuder bei der Rentenreform nicht über lädt. Das ist die grosse Gefahr. Unser Ziel ist die Sicherung des heutigen Rentenniveaus. Einige Beschlüsse sehe ich deshalb kritisch, etwa die Kürzungen bei den Witwen und Kinderrenten, aber auch den Frauenaufwertungsfaktor zum Ausgleich vermeintlicher Lohndiskriminierung.
Der Vorschlag einer Schuldenbremse für die AHV stammt von den Arbeitgebern. Was sagen Sie zur Kritik, dass die Politik damit das Fuder überlädt?
Die linken Parteien machen bewusst auf Panik. Wir wollen nicht partout das Rentenalter 67 erzwingen. Die Stabilisierungsregel würde nur greifen, wenn sich die AHV stark negativ entwickelt. Der Bundesrat und das Parlament hätten vier Jahre Zeit, um eine Lösung zu finden. Das wäre frühestens 2029 der Fall. Nur wenn die Politik nicht handelt, soll das Rentenalter schrittweise um vier Monate pro Jahr erhöht werden. 2036, in 20 Jahren also, wären wir erst beim Rentenalter 66.
Die Linke hofft, dass die Beschlüsse zur Rentenreform der Initiative AHVplus, die alle Renten um zehn Prozent erhöhen will, Aufwind geben.
Die pauschale Erhöhung der AHV-Renten wäre nicht finanzierbar. Rund 200’000 von zwei Millionen Rentnern beziehen Ergänzungsleistungen. Es wäre ineffizient, mit der Giesskanne Geld an zwei Millionen Rentner zu verteilen, weil eine kleine Anzahl Probleme hat. Zudem sind 15 Prozent der Rentner Vermögensmillionäre. Wir brauchen in der Altersvorsorge eine Gesamtschau, die ausgewogen und finanzierbar ist. Wenn wir nicht handeln, werden wir bei der AHV bis 2030 ein jährliches Umlagedefizit von 7,5 Milliarden Franken haben. Mit AHVplus würden nochmals 5,5 Milliarden hinzukommen. Die AHV hat ein demographisches Problem. Wir lösen es nicht, indem wir mehr Geld in die erste Säule pumpen.
Was würde eine Annahme der Initiative die Arbeitgeber kosten?
Die Initianten schlagen vor, dass die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer um je 0,4 Prozent also insgesamt 0,8 Prozent erhöht werden. Das ist nur die Hälfte der Miete. Wir brauchen schon 1,9 Prozent, um das Loch von 7,5 Milliarden bei der AHV zu stopfen. Im Vergleich zum heutigen Beitragssatz für die AHV von 8,4 Prozent wäre das eine Erhöhung um 30 Prozent. Eine derartige Verteuerung des Faktors Arbeit ist nicht verkraftbar, zumal die Schweiz bereits ein Hochlohnland ist. Die Rechnung für die Rentner würden einmal mehr die Erwerbstätigen bezahlen.
Die Renditen in der zweiten Säule sinken. Warum wehren Sie sich gegen eine Kompensation bei der AHV, wie sie die Gewerkschaften vorschlagen?
Der Gewerkschaftsbund wollte mit seiner Initiative erst die AHV ausbauen. Plötzlich spricht er nun von einer Kompensation von Ausfällen in der beruflichen Vorsorge. Dabei wäre es sehr gefährlich, die drei Säulen zu vermischen. Unser Dreisäulenmodell ist bewährt. Die AHV reagiert sensibel auf demographische Änderungen, die zweite Säule auf den Kapitalmarkt. Die dritte Säule gibt eine gewisse Stabilität. So sind die Risiken breiter verteilt.
Die Linke sagt, die AHV sei überlegen, weil sie nach dem Umlageprinzip funktioniert.
Die AHV ist das Sozialwerk, das am meisten umverteilt. Natürlich fänden es die Sozialisten gut, wenn künftig noch mehr umverteilt würde. Die Umverteilung für die AHV in der heutigen Form akzeptieren wir Arbeitgeber. Aber alles hat auch seine Grenzen. Wer im Jahr eine Million verdient, bekommt eine gleich hohe AHV-Rente wie jemand, der 80’000 Franken verdient, bezahlt aber zwölfmal mehr AHV-Beiträge.
Die Wirtschaft bekämpft am 25. September neben AHVplus auch die Initiative Grüne Wirtschaft. Wie stark absorbiert Sie der Kampf gegen Volksbegehren?
Ich wende rund die Hälfte meiner Arbeitszeit für das Präsidium des Arbeitgeberverbandes, welches ein Ehrenamt ist, auf. Davon brauche ich vermutlich etwa einen Drittel direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Volksinitiativen. Das ist zwar spannend, aber extrem viel. Gegenwärtig sind etwa vierzig Initiativen und Referenden hängig. Wir müssen uns Gedanken über die zukünftige Ausgestaltung der Volksrechte machen.
Inwiefern?
Unsere direkte Demokratie ist für mich das weltweit beste politische System. Anpassungen dürfen aber kein Tabu sein. Ideen gibt es unzählige. Denkbar wäre etwa, dass man die Unterschriftenzahl für eine Initiative der Anzahl Stimmbürger anpasst. Oder dass Parteien in Wahljahren keine Initiativen mehr lancieren können. Wir sollten eine Kultur entwickeln, die uns erlaubt, das Thema sachlich zu diskutieren.
Das Parlament entscheidet über die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative. Wie soll diese aussehen?
Alle müssen ihren Beitrag leisten, wenn wir die Zuwanderung senken wollen. Das gilt auch für die Wirtschaft. Wir setzen auf einen mehrstufigen, auf Berufsgruppen bezogenen Inländervorrang. Zuerst sollen die regionalen Arbeitsvermittlungsstellen die offenen Stellen abrufen können. In einer zweiten Phase sollen die Firmen diese melden müssen und innert maximal 48 Stunden eine Antwort erhalten. In einer dritten Phase wäre für gewisse Berufsgruppen, in denen die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ist, punktuell eine Nachweispflicht vorstellbar, dass man keinen passenden Inländer gefunden hat. Gut die Hälfte der Nettozuwanderung hat nichts mit der Wirtschaft zu tun, sondern etwa mit dem Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene. Auch hier sind Zusatzmassnahmen nötig.
Eine Nachweispflicht wäre fier die Unternehmen sehr bürokratisch.
Das ist nicht unser Wunsch. Aber auch die Wirtschaft muss einen zusätzlichen Beitrag leisten, wenn die Schweiz die bilateralen Verträge und die Personenfreizügigkeit mit der EU erhalten will.
Der Vorschlag dürfte auch gegen die Personenfreizügigkeit verstossen.
Es geht darum, das inländische Potenzial besser auszuschöpfen. Ich sehe kein Problem, wenn wir die Nachweispflicht auf Berufsgruppen, bei denen es keinen Mangel gibt, zeitlich und regional beschränken. Die EU hat die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit auch geschluckt.
Wegen solcher Streitfälle will die EU ein institutionelles Abkommen, quasi ein neues Dach die Bilateralen. Offenbar möchte Brüssel dies mit einer Lösung im Streit um die Zuwanderung verknüpfen. Was halten Sie davon?
Das wäre extrem gefährlich. Die institutionelle Frage ist hochkomplex und schwierig. Damit ist im Moment in der Schweiz keine Abstimmung zu gewinnen. Wir sollten die zwei Fragen unbedingt trennen.